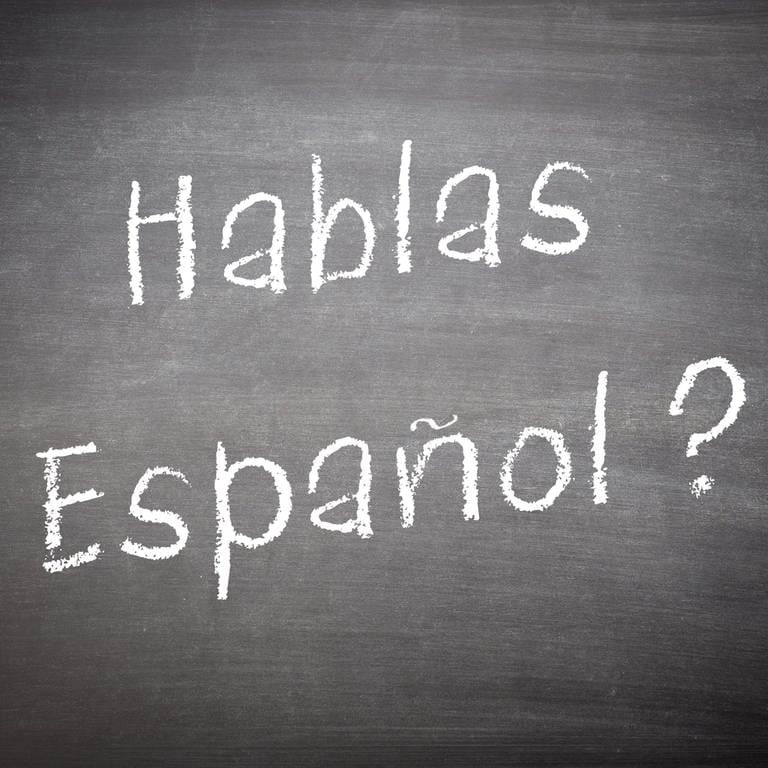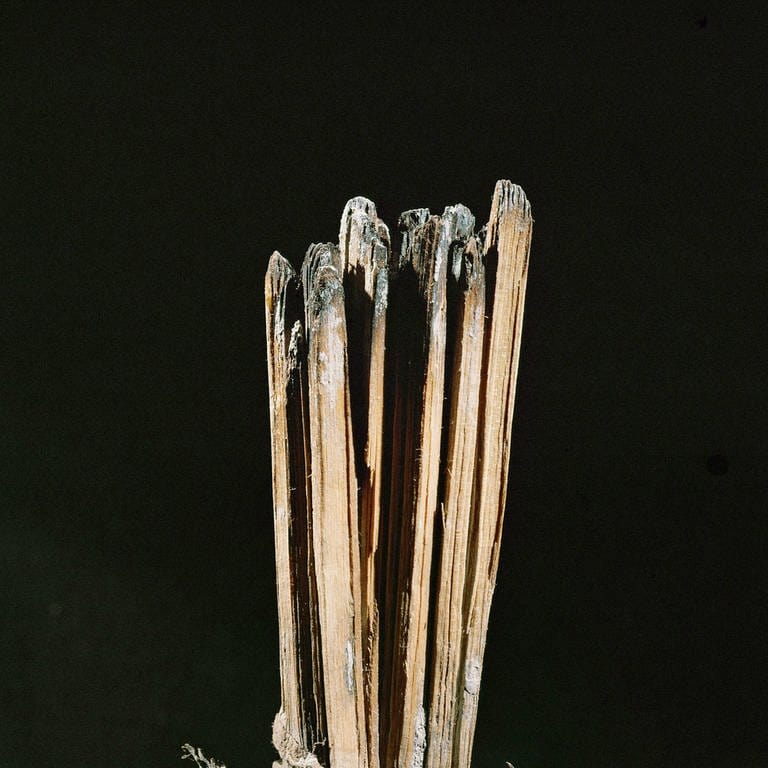Früher hat man versucht, am Schädel beziehungsweise am Gesicht eines Menschen sein Wesen zu erkennen. Sie kennen das vielleicht von der Physiognomie, dass man also an der Art, wie jemandes Nase oder Mund ist, zu erkennen versucht, was für ein Charakter er ist.
Phrenologie: der Versuch, den Charakter am Schädel abzulesen
Es gab aber auch eine richtige Schädelforschung, die Phrenologie. Die glaubte, dass man an ganz vielen Dingen des Kopfes rausfinden könnte, wes Geistes Kind jemand wäre.
Volksglaube im Spiel
Dazu gehört der alte Volksglaube, dass man hinter den Ohren so eine Art Verdickung haben könnte. Und wenn man die erfühlt, dann merkte man: Das ist jemand, der den Schalk im Nacken hat; das ist ein Schelm. Der muss nicht böse sein, aber er ist durchtrieben.
Deswegen hat man tatsächlich, etwa beim Tanzen, wie von ungefähr mal das Ohr gekrault und gefühlt: "Na, ist da was?" Und wenn da eine Verdickung war, dann wusste man: "Oh, der hat’s faustdick hinter den Ohren, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das kann ein ganz toller Schieber sein, aber vielleicht ist mit ihm nicht so gut Kirschen essen."
Redewendung "Das passt wie die Faust aufs Auge" – ist das positiv oder negativ zu verstehen?
Diese Redewendung ist schon sehr alt; sie ist spätestens im 15. Jahrhundert gebräuchlich. Im Lauf der Zeit erlebte sie einen Bedeutungswandel. Von Rolf-Bernhard Essig
Redewendung Man sagt: "Das kommt mir spanisch vor." Warum nicht italienisch oder französisch?
Als Karl der V. im Jahr 1519 zum König von Deutschland gewählt wurde, zog er mit seinem spanischen Hofstaat nach Deutschland. Zur Verwunderung der Deutschen. Karl sprach nicht gern Deutsch und wenn, dann nur mit seinem Pferd. Von Rolf-Bernhard Essig
Redensart Jemandem Hörner aufsetzen – Woher kommt das?
Die Formulierung ist sehr alt und es gibt eine Geste, bei der man den Zeigefinger und den kleinen Finger nach oben streckt und die anderen Finger nach unten beugt. Im Italienischen sagt man dann auch "Cornuto" zu einer Person und meint, er ist ein "Gehörnter". Von Rolf-Bernhard Essig