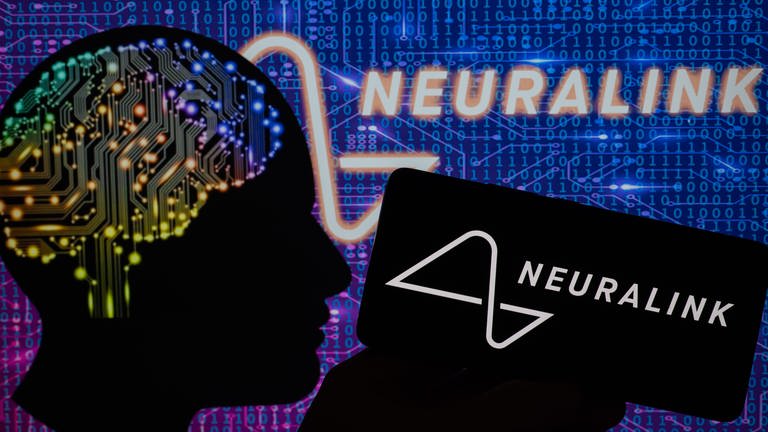"Der erste Mensch hat gestern ein Implantat von Neuralink erhalten und erholt sich gut", schreibt Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X. Nur mit Gedanken sollen gelähmte Personen zum Beispiel einen Computercursor bewegen.
Viel mehr Informationen zum Studienstart gebe es aber nicht, sagt Professor Thomas Stieglitz für Medizinische Mikrotechnik an der Universität Freiburg. Er beobachtet Neuralink schon länger:
Ich bin insgesamt doch sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit Neuralink es geschafft hat von der Firmengründung jetzt in die klinische Studie am Menschen zu kommen.
Der implantierte Chip soll Aktivität im Gehirn messen und interpretieren
2016 startete das Projekt Neuralink und machte bisher vor allem mit Tierversuchen Schlagzeilen. Affen spielten nur mit ihren Gedanken Videospiele, bei einem Schwein konnte der Chip jede Rüsselbewegung erkennen. Die Experimente waren umstritten, Affen sind nach der Implantation gestorben.
Im Mai 2023 gab die zuständige US-Aufsichtsbehörde FDA nach langem Zögern grünes Licht für die erste klinische Studie: Jetzt muss sich der Chip im menschlichen Gehirn beweisen.
Der Chip wird unter die Schädeldecke implantiert und soll Aktivitätsmuster im Gehirn messen und interpretieren können. Wenn Menschen zum Beispiel zu Bewegungen ansetzen, wird ein bestimmter Bereich im Gehirn aktiv. Die Elektroden können diese Signale messen:
Dieses Muster kann ich dann mithilfe von Computerprogrammen so umwandeln, dass ich entweder den Cursor auf dem Bildschirm steuern kann oder eine Tastatur, um irgendwas zu schreiben oder eine künstliche Roboterhand oder Arm ansteuern.
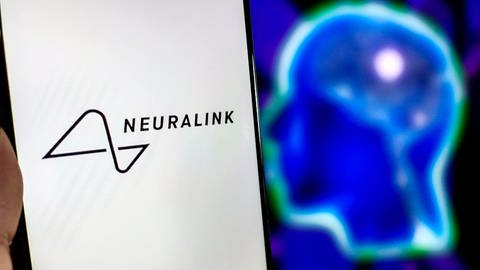
Das bedeutet: Der Patient oder die Patientin stellt sich die Bewegung nur vor, trotzdem entstehen aber typische Muster im Gehirn, die der Chip auslesen kann. Eine KI-Software kann die gemessenen Signale dann interpretieren. Zumindest bei einfachen Bewegungen funktioniert das recht gut. Das haben zahlreiche Forschungsteams gezeigt.
Die grundlegende Technik gibt es schon seit den 1990er-Jahren. In den vergangenen Jahren seien die Elektroden kleiner und effizienter geworden, sagt Thomas Stieglitz:
Als jemand, der seit 30 Jahren auf Folien mit Elektroden arbeitet, kann ich sagen, er hat gut kopiert und hat das genommen, was ein Mittelweg zwischen stabil und richtig dünn ist.
Daher ist beim Chip von Neuralink vieles nicht neu, aber der Chip fügt viele Bausteine zusammen.

Der Gehirnchip überträgt Daten über Bluetooth
Der Chip hat über 1000 Elektroden. Nach der Implantation wird die Schädeldecke wieder fest verschlossen. Bei vielen anderen Implantaten werden die Daten über ein Kabel ausgelesen und auch der Chip wird über ein Kabel aufgeladen. Der Neurolink-Chip braucht kein Kabel, lässt sich induktiv von außen drahtlos laden, überträgt die Daten über Bluetooth. Dieses Zusammenfügen von einzelnen Teilen ist die eigentliche Innovation, sagt Professor Stieglitz.
Er hat es geschafft, das alles zusammenzubringen. Und die wirklich neue Entwicklung von Neuralink ist der Roboter zur Implantation. Das ist sicherlich ein genialer Coup, weil ich damit die Präzision aus Chirurgenhand nehme. In dem Sinne, wenn ich einen Roboter habe, kann ich an vielen Stellen in vielen Kliniken das machen, ohne dass ich jetzt langwierig diese feine Implantationstechnik trainieren muss an den Menschen.
Die Technik könnte also in Zukunft in vielen Kliniken häufig eingesetzt werden. Und die Interpretation der Daten wird immer besser. Durch Modelle mit Künstlicher Intelligenz können die gemessenen Hirndaten immer genauer interpretiert werden:
Ich war sehr überrascht: Sprachdecodierung zum Beispiel, was mal die Königsdisziplin war, ist dank künstlicher Intelligenz weit vorangekommen, so dass auch wirklich schon richtig Sprache von Gehirnsignalen dekodiert werden kann. Das ist gerade vom knappen halben Jahr oder so publiziert worden von Kollegen in den USA.
Auch Querschnittsgelähmte können mit einem Roboter-Skelett dank Gehirn-Implantaten in Experimenten teilweise wieder laufen.

Elon Musk will eine Gehirn-Computer-Schnittstelle für alle, die interessiert sind
Wenn es nach Elon Musk geht, möchte er mit seinem Unternehmen nicht nur Patienten und Patientinnen mit Erkrankungen helfen, sondern eine Gehirn-Computer-Schnittstelle einer breiten Masse anbieten: So soll ein solches Implantat in Zukunft auch Befehle verstehen. Man denkt zum Beispiel an eine Frage, sucht dann die Antwort aber nicht nur in seinem eigenen Wissensspeicher im Gehirn, sondern könnte über das Implantat noch auf externes Wissen - zum Beispiel im Internet - direkt zugreifen.
Für Thomas Stieglitz ist das eher Wunschdenken. So ein Chip sei auch immer ein großer Eingriff. Er teile die Bedenken einiger Neurochirurgen, die sagen: "Aus Spaß lässt sich eigentlich keiner ein Loch im Schädel bohren." Er gibt außerdem zu bedenken, dass viele Fragen offen seien.
Wenn wir jetzt mal das Gesellschaftliche, das Ethische, mal völlig ausblenden, wissen wir noch gar nicht, was so ein Gedanke ist, wie wir den Auslesen können und wie wir ihn wieder einschreiben können. Und unser Gehirn ist an manchen Stellen auch viel intelligenter, als wir uns das manchmal wünschen.
Stieglitz verweist auf Hinweise, dass ein Gehirn zu einfache Reize ignoriert und diese Signale ausblendet. Ob sich die Zukunftsvisionen überhaupt technisch umsetzen lassen, ist also fraglich. Jetzt muss die Firma Neuralink erst einmal beweisen, dass sie mit anderen Konkurrenten beim medizinischen Einsatz mithalten kann.