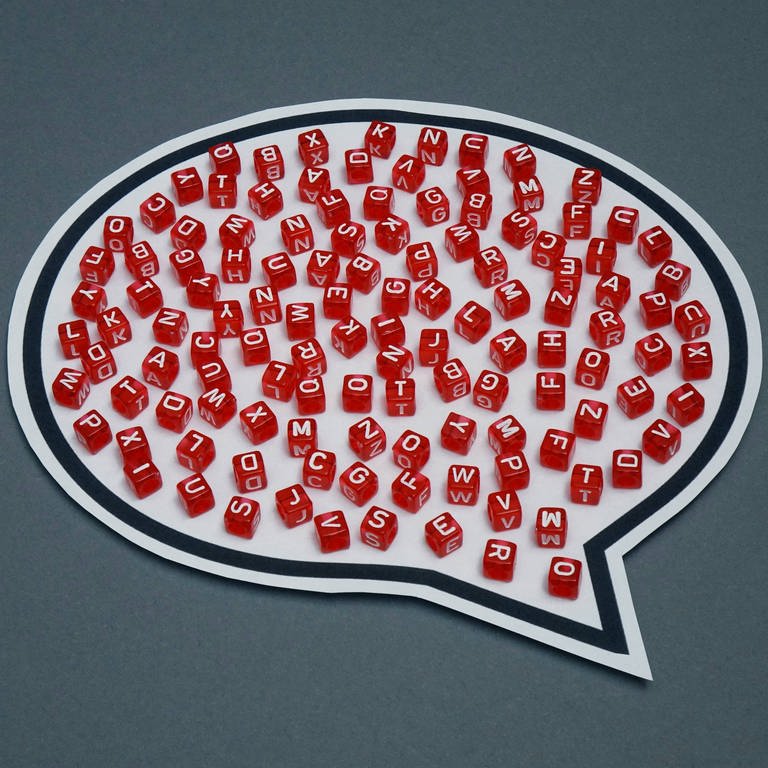Kürzlich gipfelte die "Politikersprache" darin, dass Robert Habeck im „heute-journal“ des ZDF das Wort „Alter“ gesagt hat. In dem Interview ging es darum, ob es Anreize für das Gassparen geben solle: „Es ist ja kein Spaß, den wir haben, sondern eine ernste politische Situation, die wir haben und wenn wir uns da nicht gegenseitig helfen, dann kommen wir da nicht durch. Wenn da nochmal jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro krieg, würde ich sagen, kriegst du nicht, Alter.“
Albrecht Plewnia vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim stellt klar, warum die Aussage bei vielen im Kopf so präsent war:
„Man muss sagen, dass (...) die Irritation über diese eine Aussage auch deswegen so gut funktioniert, weil es gerade nicht der übliche Duktus ist, und zwar weder von Politikerinnen und Politikern allgemein, noch von Robert Habeck im Speziellen."
Kognitive Dissonanz - Handlung und Erwartung passen nicht zusammen
Robert Habeck redet als Spitzenpolitiker gerne mal frei, fern von Sprechzetteln und Schachtelsätzen. Auch der Satz „Da habe ich keinen Bock drauf“ fiel schon einmal. Solche Formulierungen sind nicht das, was wir als den üblichen Sprachstil von Politikerinnen und Politikern erwarten würden. Doch genau um diesen Bruch geht es:
„Es gibt eine bestimmte Tradition des Formulierens, die an bestimmte Domänen bestimmter sozialer Sachbereiche gebunden sind. Das gilt beispielsweise für den politischen Kontext oder ökonomische Zusammenhänge. Das gilt aber auch im kirchlichen Kontext. Sie haben eine bestimmte Erwartung davon, wie ein Pastor eine Pastorin zu sprechen hat, einen bestimmten Duktus, mit dem sie rechnen", erklärt Sprachforscher Plewnia, "und wenn diese Erwartungshaltung in irgendeiner Weise durchbrochen wird, dann kann das eben ein Irritamentum produzieren.“
Irritamentum ist ein lateinischer Begriff und bedeutet Reizmittel. Wenn Robert Habeck also „Alter“ sagt, reizt das viele Menschen, positiv wie negativ. Das war auch anhand der unterschiedlichen Reaktionen zu sehen: Während viele Habeck im Netz als “geilen Typen” feierten, titelte eine genervte Autorin in der TAZ hingegen: „Kumpel mich mal nicht so an, Alter“.

Vor allem ärgerte sich die Autorin darüber, wen Habeck mit „Alter“ eigentlich ansprechen wollte. Damit seien eben nicht vor allem irgendwelche Industrievertreter- oder vertreterinnen gemeint, denen Habeck nämlich sehr wohl Anreize zum Gassparen angeboten habe. Sondern am Ende die „kleinen Leute“. Diesen Begriff will Habeck, das stellte er in einem Spiegel-Interview klar, im Übrigen auch nicht mehr verwenden, weil das Menschen erniedrige.
Nicht nur Habecks Sprache fällt auf
Auch die Sprechweise von Außenministerin Annalena Baerbock wird als volksnäher und direkter bezeichnet: „Wenn mittags Wodkatrinken Härtetest ist… ich habe zwei Kinder geboren“ konterte sie bei einem Treffen Anfang des Jahres mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow auf dessen Aufforderung, zum Mittagessen anzustoßen.

Bei der UN-Vollversammlung, als es darum ging, ob die Vertreterinnen und Vertreter der 192 Mitgliedsstaaten eine Resolution unterstützen wollen, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt, holte Baerbock mit ihrer Sprechweise den Krieg ganz nahe heran, an den Esstisch jedes einzelnen:
„Wenn wir nach unserer Abstimmung nach Hause gehen, wird jeder von uns am Küchentisch unseren Kindern, unseren Partnern, unseren Freunden, unseren Familien gegenübersitzen müssen. Dann muss jeder von uns ihnen in die Augen schauen und ihnen sagen, welche Wahl wir getroffen haben.“
Es waren Worte, die zu Baerbock passten. Und zu der Situation. Eine Fähigkeit, die nicht jede Politikerin und jeder Politiker gleichermaßen mitbringt, wie man auch bei ihrer Rede in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem bei ihrem Antrittsbesuch in Israel deutlich hören konnte: „Der Gedanke an den Schmerz jedes einzelnes Kindes, jeder einzelnen Mutter, jedes einzelnen Vaters ist kaum zu ertragen.“
Ihre Stimme stockte bei diesem Satz. Sie transportierte ihr Gefühl ehrlich über die Sprache. Authentisch sein ist ein wichtiges Kriterium, wenn es darum geht, welche Sprache für wen funktioniert, erklärt Sprachwissenschaftler Plewnia.

Rhetorik als Faktor allein führt nicht zu mehr Beliebtheit
Laut einer aktuellen Umfrage ist Baerbock derzeit die beliebteste Politikerin Deutschlands, dicht gefolgt von ihrem Parteikollege Robert Habeck. Doch das allein nur den Rhetorikkünsten der beiden zuzuschreiben, sei falsch:
„Denken Sie an Frau Merkel, die lange Zeit die beliebteste Politikerin war und die nun wiederum gerade nicht als eine Person gilt, die rhetorische Feuerwerke abfeuert. Da können Sie sehen, dass dieses Beliebtheitsnetz aus verschiedenen Fäden gesponnen ist. Was eine wesentliche Rolle dabei zu spielen scheint, wie positiv oder negativ Bewertungen von Bürgern und Bürger vorgenommen werden, das ist, ob eine Person glaubwürdig ist, passt das, wie sie spricht mit dem was wir sonst als Bild von ihr haben. Und das scheint bei Habeck und Baerbock zunehmend zu gelingen“, so Sprachwissenschaftler Plewnia.
Annalena Baerbock kann authentisch als Mutter sprechen, was sie ja auch gerne mal tut, weil sie eben eine ist. Olaf Scholz, der ja eher für seine kühle hanseatische Art bekannt ist, zu raten, er sollte vielleicht auch mal öfter „Alter“ sagen, das würde dann doch eher nach hinten losgehen. Außerdem ist Sprache nicht gleich Sprache:
„Es heißt ja beispielsweise vom Bundeskanzler, dass er ein sehr erfolgreicher Verhandler sei und dass er in der Regel imstande ist, in Verhandlungsrunden hinter verschlossenen Türen ziemlich zuverlässig das zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. Und das ist in aller Regel nicht mit der mit Macht von Gewalt, sondern mit Überzeugung und guten Argumenten. Und das ist aber eine andere Art von kommunikativer Fähigkeit als die, über die wir jetzt gerade in Bezug auf die Frontleute der Grünen sprechen.“

VertreterInnen einer neuen Generation von Politikern
Es ist auch kein Zufall, sagt Sprachwissenschaftler Albrecht Plewnia, dass gerade Habeck und Baerbock auffallen in ihrer Art zu sprechen, weil genau das ihre Rolle ist und von ihnen erwartet wird: „Habeck und Baerbock stehen im Zentrum des Interesses, weil sie als Vertreterin, Vertreter einer der neuen Generation von Politikerinnen Politiker gesehen werden, die eben gleichzeitig für einen bestimmten gesellschaftlichen Aufbruch steht. Und die Erwartung ist, dass sich das in irgendeiner Weise spiegeln müsste, eben auch im Sprachverhalten."
Dass Baerbock und Habeck diese “andere” Sprache brauchen, liegt auch an der weltpolitischen Lage, die von den beiden Politikern Positionierungen erfordert, die eigentlich im Widerspruch stehen zu dem, was sie ursprünglich mal wollten, vermutet der Sprachforscher Plewnia. Sie müssen Dinge erklären, für die die Grünen eigentlich nicht stehen. Aufrüstung, mehr Strom aus Kohlekraftwerken, Gas-Deals in Katar.
„Wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde (...). Was immer wir tun, hat Konsequenzen, wir sind keine Engel, aber wir können versuchen, die Konsequenzen ein bisschen weniger schlimm zu machen." Es sei nur folgerichtig so zu sprechen.

Wahlentscheidungen werden nach anderen Kriterien getroffen
Doch am Ende sollte man diese „andere“ Sprache nicht überbewerten, sagt der Germanist Albrecht Plewnia:
„Man darf die Wirkung von einzelnen Politikern und Politikerinnen, also die Sprechweise für konkrete Wahlentscheidungen vieler Menschen, nicht überschätzen. Das mag sicherlich im Bereich Nachkommastellen eine Rolle spielen, aber die meisten Wahlentscheidungen werden nach wie vor gefällt aufgrund längerer loyaler Bindungen, auf Grund einer gefühlten Übereinstimmung eines bestimmten kulturellen Settings, das mit einer Partei verbunden wird und dem, was man selber für sich wünscht und Ähnliches.“
Es wird sich also zeigen, wie viel Erfolg diese Art der Kommunikation tatsächlich hatte, wenn die nächsten Wahlen anstehen. Dass gerade auch viele jüngere Menschen ihnen lieber zuhören, sie besser verstehen, dieser Erfolg ist Habeck und Baerbock aber jetzt schon mal gewiss.