Das Abitur ist längst nicht mehr die Prüfung für eine kleine Bildungselite, sondern ein Massenabschluss. Im Jahr 2018 haben 433.000 Menschen in Deutschland die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben. Sie können ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule aufnehmen.
Hat bei den 60- bis 64-Jährigen nur etwa jeder Vierte das Abitur, sind es bei den 20- bis 24-Jährigen etwa die Hälfte. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Auch der Anteil der "Einser-Abis" ist (leicht) gestiegen.
Wie aussagekräftig sind die Abi-Noten?
Lassen sie sich vergleichen? Oder ist ein Abitur in Bayern mehr wert als das in Berlin?
Seit 2006 veröffentlicht die Kultusministerkonferenz jährlich Zahlen, die zeigen, wie die Schüler eines Bundeslandes beim Abitur abgeschnitten haben. Schüler aus Thüringen und Sachsen liegen dabei in der Regel deutlich vorne. 2017 lag der Abitur-Schnitt in Thüringen bei 2,18. Schüler aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz dagegen landeten bei einem Schnitt von 2,4 oder 2,5.
Jedes Bundesland hat andere Anforderungen an Schüler
Eigentlich handelt es sich nur um geringe Unterschiede – die aber bei der Bewerbung um einen Studienplatz darüber entscheiden können, ob es mit der Wunsch-Uni klappt oder nicht.
Bundeseinheitliche Abitur-Prüfung?
Immer wieder wird der Ruf nach bundeseinheitlichen Abiturprüfungen laut. Allerdings: Die Abiturnote setzt sich nicht nur aus den Abi-Prüfungen zusammen, sondern auch aus den anderen Noten, die die Schüler im Laufe der Oberstufe bekommen. Und da haben Lehrer oft unterschiedliche Systeme, um ihre Schüler zu bewerten.

In jedem Bundesland gibt es für Schüler andere Anforderungen.
- Welche Pflichtfächer Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur belegen müssen, ist in jedem Bundesland anders geregelt.
- In jedem Bundesland setzt sich die Schülerschaft anders zusammen. In manchen Bundesländern gelingt der Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium leichter, in anderen gibt es größere Hürden.
Seit vielen Jahren machen sich Bildungspolitiker, Schulforscher und Lehrervertreter Gedanken darüber, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn erwerben sollten und wie die Qualität des Unterrichts gesichert werden kann. Wie wichtig vergleichbare Schulleistungen und eine bestimmte Qualität der Bildung sind, formulierte die Kultusministerkonferenz 1997 in ihrem Konstanzer Beschluss.
Ernüchternde Vergleiche mit Pisa und Timss
Außerdem entschied die Kultusministerkonferenz zu dieser Zeit, an internationalen Vergleichsstudien teilzunehmen. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre zeigten internationale Vergleichsstudien wie Pisa oder Timss, dass die deutschen Schüler in Mathematik und in den Naturwissenschaften nicht mit den Schülern aus anderen Ländern mithalten konnten.
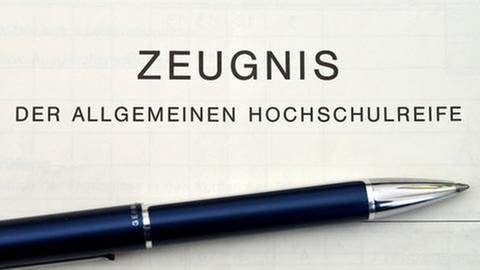
Um gegenzusteuern, entwickelten die Länder Anfang der 2000er Jahre Bildungsstandards zunächst für die Grundschule, später auch für die Sekundarstufe 1. Die Bildungsstandards sind sehr umfangreich, für das Fach Deutsch umfassen sie rund 200 Seiten. Und sie sind Basis für die Entwicklung des bundesweiten Abiturpools, der den Ländern seit 2017 zur Verfügung steht, um die Klausuraufgaben für das Abitur bundesweit vergleichbarer zu machen.
Doch am gemeinsamen Aufgabenpool gibt es viel Kritik. Die Länder können sich aus dem Pool bedienen, müssen es aber nicht. Und selbst wenn sie es tun, können sie die Aufgaben verändern. So kann es passieren, dass Schüler im Fach Mathematik ganz andere Aufgabenstellungen erhalten – obwohl sich die Länder aus demselben Pool bedienen.
Petition gegen Auswahl der Abituraufgaben
Was im Frühjahr 2019 dazu führte, dass sich Schüler aus mehreren Bundesländern massiv über die Aufgabenstellung im Mathe-Abitur beschwerten. Rund 75.000 Schüler unterschrieben eine Petition zur Neubewertung der Klausuren, da die Abiturprüfungen ihrer Meinung nach Aufgaben enthielten, die in dieser Form nicht im Unterricht behandelt worden waren. Teile der Geometrie- und Stochastik-Aufgaben seien so schwer gewesen wie in keiner anderen Abitur-Prüfung zuvor.
Es bleibt also bei einem System, das eigentlich nicht vergleichbar sein kann. Und trotzdem entscheidet die Abiturnote darüber, welchen Weg Abiturienten nach der Schule einschlagen können.







