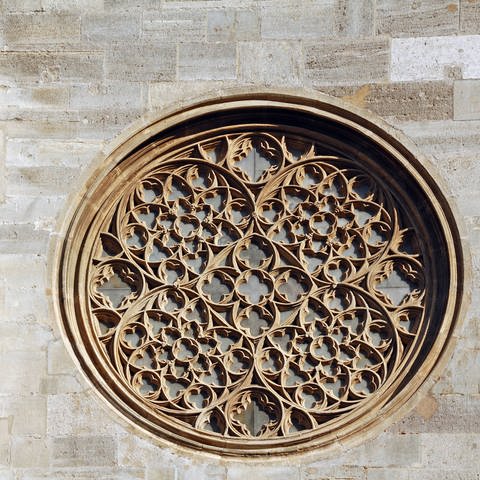Mehrweg: Flaschenindustrie kann dem Abfüller neue Flasche verkaufen
Hier kommt es darauf an, ob es sich um Einweg- oder Mehrweg-Verpackungen handelt. Bei Mehrweg ist es so: Der Abfüller – also z.B. der Bier- oder Mineralwasserproduzent – erhebt ein Pfand, meist 15 Cent. Das wird in dieser Höhe über den Handel bis zum Verbraucher durchgereicht. Wenn ich die Flasche zurückgebe, gehen die 15 Cent in derselben Kette zurück. Der Abfüller erhält seine Flasche wieder und kann sie neu befüllen.
Bringe ich die Flasche nicht zurück, verzichte ich auf 15 Cent. Den Händlern ist das egal – sie wären eh nur Zwischenstation, für die Flaschen ebenso wie für die 15 Cent. Wem es aber nicht egal ist, ist der Abfüller. Der kriegt die gebrauchte Mehrweg-Flasche nämlich nicht zurück und muss sich stattdessen eine neue Flasche besorgen – und die kostet ihn meist mehr als 15 Cent. In diesem Fall profitiert also die Flaschenindustrie, die dem Getränkehersteller eine neue Flasche verkaufen kann.
Bei Einweg profitiert der Abfüller
Da funktioniert das anders, denn das Einweg-Pfand hat eine andere Funktion. Hier ist es nicht der Getränkehersteller, der seine Flasche "zurückkauft", sondern die Politik will über das Pfand erreichen, dass Flaschen und Dosen nicht in der Landschaft landen. Sie sollen stattdessen geordnet gesammelt und ggf. das Material recycelt werden.
Für die Verbraucher läuft das Spiel scheinbar ähnlich: Die Hersteller schlagen auf den Verkaufspreis 25 Cent drauf, den müssen die Händler zahlen und holen sich die 25 Cent dann beim Konsumenten wieder.
Ist die Flasche leer getrunken, kann ich sie zurückgeben, und zwar bei jedem Getränkehändler, der Einwegflaschen oder -Dosen verkauft – unabhängig davon, ob er genau diese Marke im Sortiment hat. Dort bekomme ich für die Flasche 25 Cent.
Ab jetzt läuft das Spiel aber anders: Die Getränkehändler bringen die Flasche nicht zurück zum Hersteller, sondern liefern sie in einem sogenannten Zählzentrum ab. Dort werden die Flaschen gesammelt und gescannt, sodass das Zählzentrum z.B. feststellt: Der Getränkehändler hat 100 Dosen „Spartaner-Bier“ abgeliefert. Dafür bekommt er von der (fiktiven) „Spartaner-Brauerei“ das Pfand ausgezahlt – nur dass die Brauerei keine Flasche dafür bekommt. Sie zahlen die 25 Cent quasi als Beitrag zum Umweltschutz.
Werfe ich die Flasche dagegen in den Müll, verzichte ich auf 25 Cent – und davon profitiert am Ende der Abfüller, denn der kann das Geld behalten. Mit der Flasche hätte er eh nichts anfangen können.
"Pfandschlupf" liegt bei etwa 3 Prozent
Heute werden schätzungsweise 3 Prozent der Einweg-Flaschen nicht zurückgegeben . Früher war es noch viel mehr. Die Getränkewirtschaft spricht hier vom „Pfandschlupf“. Das bedeutet aber: Bei jeder 30. Flasche oder Dose bekommt der Abfüller beim Verkauf 25 Cent vom Verbraucher, die er aber am Ende nicht zurückzahlt. Bei vielen Millionen nicht zurückgebrachter Flaschen kommen da mindestens sechsstellige Beträge zusammen.