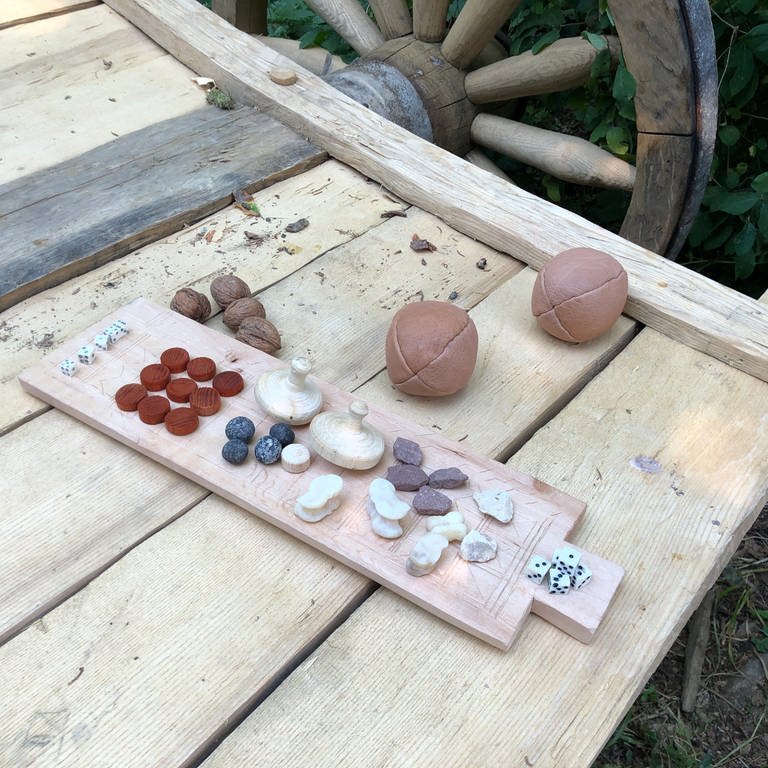Vor 1.200 Jahren gab es kein Antibiotikum oder Aspirin. Die Menschen griffen auf das zurück, was vor ihrer Haustür wuchs: Wild und Heilkräuter. Schon im St. Galler Klosterplan, nach dem auf dem Campus Galli bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ein frühmittelalterliches Kloster nachgebaut wird, ist ein Klostergarten eingezeichnet. Den kann man auf dem Campus Galli bewundern. Mit genau den Heilpflanzen, die damals schon eine große Wirkung bei großen und kleinen Krankheiten hatten.

Salbei galt früher als blutstillend und harntreibend
Hinter einem hellen Holztörchen, umgeben von einem dunklen Weidenzaun, liegt sie: die frühmittelalterliche Apotheke auf dem Campus Galli. Neben einem mit Steinen eingefassten, rechteckigen Beet sitzt Rowena und schnuppert genüsslich an den eiförmigen Blättern des Salbeis. Früher wurde er eingesetzt, um Blutungen zu stillen oder bei Harnwegserkrankungen. Heute trinkt man gerne mal einen Salbeitee, wenn es im Hals kratzt und juckt.
16 Pflanzen im Heilkräutergarten
Rowena ist ausgebildete Wildpflanzenpädagogin. Sie kümmert sich um die 16 Pflanzen, die im Heilkräutergarten wachsen. Es sind genau die Pflanzen, die auch im St. Galler Klosterplan bereits eingezeichnet sind. Jede einzelne von ihnen war damals und ist auch heute ein kleines Kraftpaket. Wobei heilsam nicht immer gleich lecker bedeutet, meint Rowena schmunzelnd.
"Gut, besser, bitter. Die Bitterstoffe sind richtig klasse für die Gesundheit."

Giftige Weinraute bei Sonnenschein
Fast schon zärtlich streicht Rowena über Rosmarinzweige und Bohnenkrautstängel. Sie läuft vorbei an Fenchel und Rosenstauden, auf denen Bienen nach Nektar suchen. Vor einem Beet mit einer gelb blühenden Pflanze bleibt Rowena stehen. "Giftig" steht auf dem kleinen Tonschildchen bei der Weinraute. Wenn die Sonne auf die Blüten scheint, reagiert die Pflanze phototoxisch. Das heißt bei Berührung und gleichzeitiger starker Sonneneinstrahlung kann sie teilweise starke Hautreizungen und Haut-Verfärbungen bis hin zu einer Art Brandblasen auslösen. Auch Rowena hat sich schon an dem Heilkraut verbrannt. Sie ist deshalb sehr vorsichtig geworden.

Im Mittelalter half die Weinraute gegen Schlangenbisse oder Vergiftungen. Neben der giftigen Raute reckt die Schwertlilie ihre lila Blüten in die Höhe: Auch sie ist ein Muss in jedem mittelalterlichen Kräutergarten. Im Mittelalter half die Wurzel der Lilie, geschält und in Wein eingelegt, gegen Blasenbeschwerden.

Die kleinen Wilden wuchern am Weidenzaun
Ein ganz besonderer Schatz der mittelalterlichen Heilkunde wächst allerdings nicht im Beet, sondern wuchert entlang des Weidenzaunes. "Meine kleinen Wilden" werden sie liebevoll von Rowena genannt. Gemeint sind Brennnessel und Giersch. Rowena geht in die Knie und streicht vorsichtig von unten an die Spitze der Nessel, ohne sich zu verbrennen. Im Mittelalter war die heute doch oft so verkannte Brennnessel eine wichtige Pflanze. Manchmal sogar ein Lebensretter. Bei Hungersnöten wurde sie gegessen und füllte so den Magen der darbenden Bevölkerung. Der Giersch wurde schon im Mittelalter bei Herzgefäßbeschwerden, Gicht, Rheuma und Ischiasschmerzen angewendet.

Hexenkraut gegen schlechte Laune
Neben dem Giersch wächst eine zarte, auf den ersten Blick eher unscheinbare Pflanze. Die kleinen weißen Blüten des Hexenkrauts sehen ein bisschen aus wie kleine, verwunschene Feen. Rowena beugt sich lächelnd zu ihr hinab. Im Mittelalter gab es den Glauben: Wenn man die Pflanze räucherte oder jeden Tag eine kleine Blüte davon aß, wurden aus mürrischen Menschen freundliche Wesen.