Die Konstanzer Wissenschaftlerin der Universität hat gemeinsam mit anderen Forschern mehrere Hummel-Kolonien in zwei Hälften geteilt und ihnen weniger Nahrung gegeben. Zusätzlich wurde jeweils eine Kolonie-Hälfte dem Pflanzengift Glyphosat ausgesetzt. Dabei konnten die Biologen beobachten, dass die Hummeln, die Glyphosat ausgesetzt waren, ihre Brut weniger lang bei 32 Grad wärmen konnten. Eine gemeinsame Wärmeregulation sei für die Kolonie-Entwicklung jedoch von herausragender Bedeutung, so die Forscher. Nur bei solch hohen Temperaturen entwickele sich die Brut schnell vom Ei zur Hummel und die Kolonie von einer einzelnen Königin zu einem Volk mit mehreren hundert Tieren.
Hummeln ohne Glyphosat können Temperatur länger halten
Die anderen Hummeln, die dem Glyphosat nicht ausgesetzt waren, konnten die Temperatur länger halten - trotz knapperer Nahrung. Die Studie zeige einen deutlichen Einfluss von Glyphosat auf die kollektive Wärmeregulationsfähigkeit von Hummelkolonien und somit auf ihre Entwicklungsfähigkeit, so die Forscher.

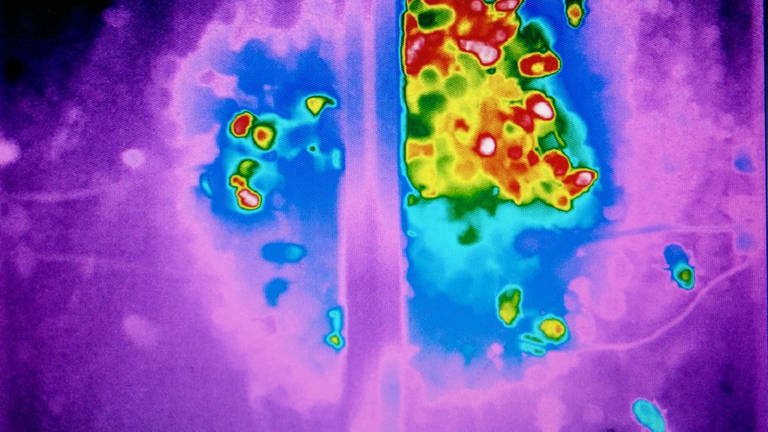
Grund für massives Insektensterben?
Diese versteckte Folge des Pflanzengiftes könnte eine Ursache des massiven Insektensterbens in den vergangenen 30 Jahren sein, so die Konstanzer Wissenschaftlerin Anja Weidenmüller. Bei Zulassungsverfahren für Chemikalien in der Landwirtschaft sollten solche versteckten Folgen darum künftig auch getestet werden.
"Es lohnt sich, genauer hinzugucken."
Bisher werde in Zulassungsverfahren lediglich getestet, wie viele Tiere nach Fütterung oder Kontakt mit einer Substanz nach 24 oder 48 Stunden gestorben sind. "Subletale Effekte, also Effekte auf Organismen, die nicht tödlich sind, sich aber zum Beispiel in der Physiologie oder im Verhalten zeigen, können erhebliche Beeinträchtigungen abbilden und sollten bei Zulassungen von Pestiziden zukünftig mit in Betracht gezogen werden", fordert die Forscherin. In ihrer Studie lebten auch die mit Glyphosat belasteten Hummeln im Schnitt 32 Tage, erreichten also ein durchschnittliches Hummel-Alter. Die Tiere konnten sich aber in Stresssituationen wie knapper Nahrung nicht ausreichend fortpflanzen.
Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer erklärt die Konstanzer Wissenschaftlerin Anja Weidenmüller die Studie.
Insektensterben ist ein ernsthaftes Problem
Der Rückgang der Insekten und insbesondere der bestäubenden Insekten bedroht Ökosysteme und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, so die Uni Konstanz. Die enormen Ausmaße zeige eine Krefelder Studie von 2017: Demnach ging in Deutschland die Zahl aller fliegenden Insekten zwischen 1989 und 2016 um 76 Prozent zurück. Der immer weiter zunehmende Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft gilt als ein Treiber dieses Phänomens.




