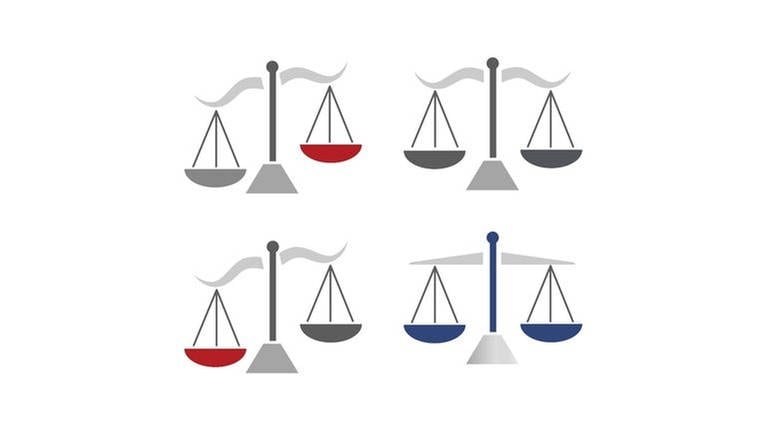Fehlurteile: peinlich für die Justiz, tragisch für die Betroffenen
Ein Mensch, der kein Verbrechen begangen hat und trotzdem zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, muss seine Familie zurücklassen, verliert seine Arbeitsstelle, vielleicht seine Wohnung, die er nun nicht mehr abbezahlen kann, sitzt tagein tagaus im Gefängnis. Verliert wertvolle Lebenszeit, Monate, Jahre. Für die Justiz sind diese Irrtümer mehr als peinlich.
Doch auch Richterinnen und Richter können irren, weiß Sabine Rückert. Sie hat jahrelang als Gerichtsreporterin für die Wochenzeitung "Die Zeit" gearbeitet. Mittlerweile ist sie stellvertretende Chefredakteurin und betreibt mit "Zeit Verbrechen" den erfolgreichsten True-Crime-Podcast Deutschlands. Mit einer ihrer Recherchen hat Sabine Rückert zwei zu Unrecht verurteilten Männern zu einem Wiederaufnahme-Verfahren verholfen und schließlich einem Freispruch.
Schwierigkeiten eines Wiederaufnahmeverfahrens
Doch Wiederaufnahmeverfahren können an vielen Aspekten scheitern: an fehlenden finanziellen Mitteln der Verurteilten. An den Möglichkeiten, neue Beweise zu recherchieren. Und auch an der grundsätzlichen Einstellung der Justiz: Sie korrigiert sich nicht gerne, möchte keine Ressourcen für bereits abgeschlossene, oftmals langwierige Prozesse aufwenden.
Außerdem müsste der Staat an zu Unrecht Verurteilte eine Entschädigung zahlen. Zusätzlich zum Ersatz des Verdienstausfalls liegt diese bei pauschal 75 Euro pro Tag. Von diesen 75 Euro zieht die Justiz aber noch Geld ab – unschuldig Verurteilte müssen nämlich unter Umständen für Kost und Logis im Gefängnis bezahlen.

Schriftliche Anklage schildert das Tatgeschehen aus Sicht der Staatsanwaltschaft
Für den Berliner Rechtsprofessor Carsten Momsen beginnen die Probleme oft schon vor der Hauptverhandlung. Nämlich mit den Informationen, die das Gericht über den zu verhandelnden Fall erhält. Es ist die Staatsanwaltschaft, die diese Informationen recherchiert und zusammenstellt. In dieser schriftlichen Anklage erzählt die Staatsanwaltschaft vor allem ihre Version der Geschichte.
"Anklagen sind durchgängig überzeugend. Das muss man einfach mal sagen. Da versteht die Staatsanwaltschaft den Job."
Bereits bevor die Hauptverhandlung beginnt, kennen die Richterinnen und Richter also eine Version des Tatgeschehens, das sie für hinreichend wahrscheinlich halten. Nämlich die der Staatsanwälte und nicht die der vermeintlichen Täter.
"Ich glaube, es gibt wenige Verfahren, in denen die Ermittlungsbehörden böswillig, korrupt irgendwas ausblenden. Sondern die Gefahr ist vielmehr, dass man sich auch als ermittelnder Beamter irgendwann die Geschichte zurechtlegt und denkt: So muss es gewesen sein. – Und dann fängt man an, danach zu selektieren, willkürlich oder unwillkürlich."
Revision bezieht sich nur auf das Urteil und die Anwendung des Rechts
Am Ende spricht das Gericht ein Urteil. Wenn dieses Urteil in den Augen des Angeklagten oder der Staatsanwaltschaft falsch ist, bleibt zunächst nur ein Rechtsmittel:
"Die sogenannte Revision. Das geht zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe oder Leipzig. Und dort befasst sich der Senat dann nur mit Rechtsfragen. Das heißt, es wird nicht mehr überprüft: Was hat ein Zeuge wirklich gesagt? Das, was im Urteil steht, oder was anderes? Sondern es wird nur überprüft, ob das Landgericht das Recht richtig angewendet hat. Das heißt, die sogenannte Tatsachengrundlage des Urteils kann nicht mehr überprüft werden. Das ist eine Besonderheit im deutschen System."
Die Revision bezieht sich allein auf das Urteil. Doch darin können Richter entscheidende Dinge nicht erwähnen oder das Urteil enthält Fehler. Sabine Rückert findet deutliche Worte:
"Jeder Pilot, der fliegt, hat eine Maschine, die ihn korrigiert, wenn er Fehler macht. Aber in der Justiz ist das nicht so. In der Justiz wird jemand verurteilt, und dann geht die Sache an den Bundesgerichtshof. Da liest es dann einer. Und der eine referiert dann den Stand der Dinge der Sitzgruppe. Und dann wird darüber abgestimmt, und dann wird es verworfen. Und zwar fast immer. So läuft das. So wie Sie und ich, wir sitzen beisammen und reden über den Fall. Das sind jetzt die Kontrollmechanismen."
Wortgenaue Protokolle werden in Strafverfahren nicht geführt, der Prozess wird auch nicht per Video oder als Audio aufgenommen, erläutert Sabine Rückert.
Die Kosten seines Verfahrens muss der oder die Verurteilte tragen
Meistens sind bei großen Verfahren schnell alle finanziellen Rücklagen aufgebraucht. Wer erst einmal im Gefängnis sitzt, hat kaum Verdienstmöglichkeiten. Geld für einen Anwalt ist nicht da. Und selbst mit einem Anwalt bleiben die Chancen gering, dass ein Wiederaufnahme-Antrag angenommen wird. Und die personell immer knapp ausgestattete Justiz ist froh über jeden Fall, den sie erledigt hat.
"Innocence Project" konnte in den USA zahlreiche Fehlurteile aufdecken
In diesem Video des amerikanischen "Innocence Project", das zwei Strafverteidiger, Peter Neufeld und Barry Scheck, 1992 an einer Law School in New York gegründet haben, erzählen einige Betroffene ihre Geschichte. Gemeinsam mit vielen Studierenden haben die Gründer mehr als 300 Fehlurteile allein mithilfe von DNA-Analysen aufgedeckt. 3.777 Jahre haben die Klienten des amerikanischen Projekts bisher unschuldig im Gefängnis verbracht.
Hilfe für unschuldig Verurteilte: neues Projekt in Deutschland
In Deutschland gibt es seit Kurzem eine ähnliche Initiative wie das amerikanische "Innocence Project". Gemeinsam mit dem Berliner Anwalt Prof. Stefan König hat Carsten Momsen das Projekt "Fehlurteil und Wiederaufnahme" ins Leben gerufen. Verurteilte können sich an das Projekt wenden, das dann prüft, welche Möglichkeiten es geben könnte, Urteile anzugreifen. Momsen und König arbeiten honorarfrei, ehrenamtlich unterstützt von weiteren Juristen und Juristinnen und von mehreren Studierenden.
Denn das ist die Realität in Deutschland: Menschen, die verurteilt werden, haben kaum Chancen auf eine Korrektur. Wie könnte sich das ändern?
"Es wäre wichtig, dass die Beweiswürdigung im Rechtsmittel überprüfbar wird. Vollständig. Und zwar eben auch anders als nur nach Formalkriterien, dass man sie inhaltlich nachvollziehen kann. Und [...] es wäre wichtig, dass das Wiederaufnahme-Recht so gestaltet wird, dass es zugänglich wird für die Betroffenen. Das glaube ich fast, das ist das Entscheidende, dass der faktische Zugang gesichert wird."
Doch ernsthafte politische Bestrebungen dazu gibt es nicht.