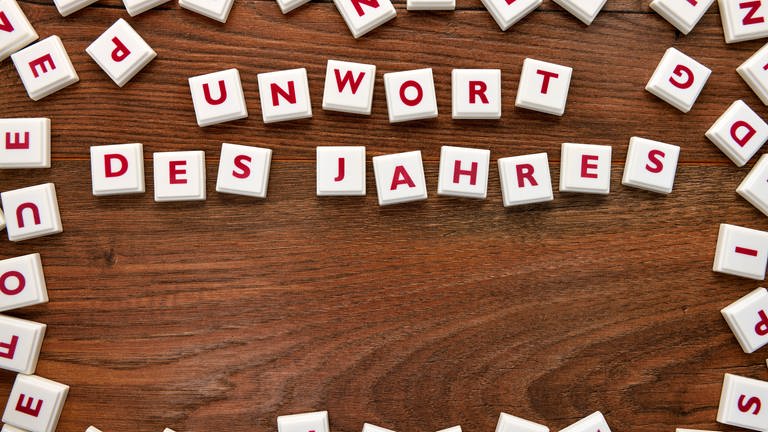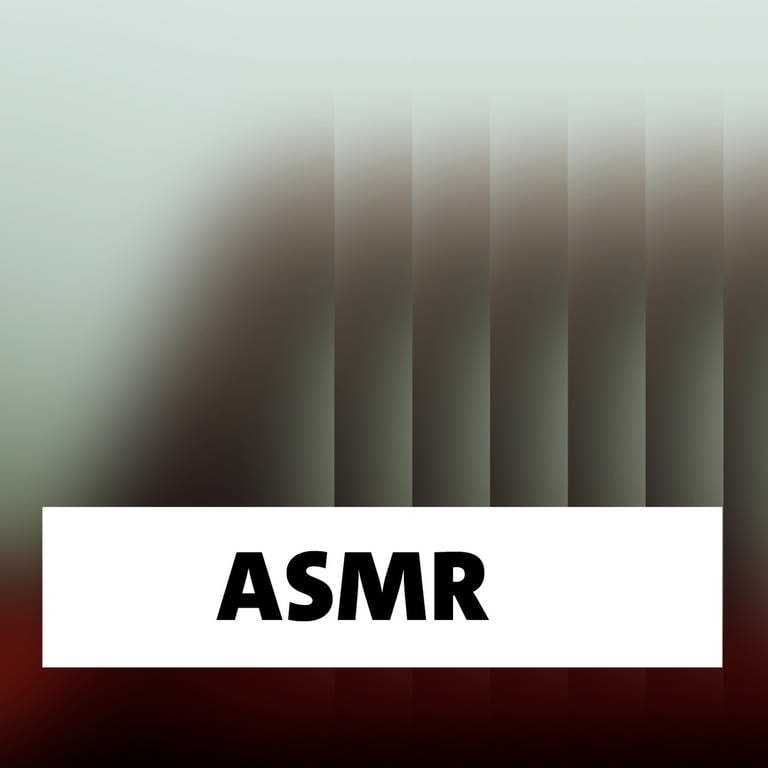Shutdown und Lockdown sind Wörter, die während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen haben. Gemeint ist mit beiden Begriffen das Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens. Sprachforscherin Annette Klosa-Kückelhaus erklärt, was es damit auf sich hat.
Der „Shutdown“
Das englische Wort „shutdown“ sei eigentlich ein Verb, so Klosa-Kückelhaus, und bedeute „abschalten“ oder „herunterfahren“ des Computers. Ursprünglich aus der IT-Fachsprache, wo es das Zusammenbrechen digitaler Prozesse bezeichnet, wird es jetzt auf den gesellschaftlichen Zustand übertragen – und bezeichnet dann die Quasi-Stilllegung des gesellschaftlichen Lebens.

Andere Beispiele für Wörter aus der Fachsprache, die durch die Corona-Krise in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind, findet man in der Epidemiologie: Infektionsketten, Aerosole, Risikogruppen oder Mund-Nasen-Schutz. Die Krise habe besonders anschaulich gezeigt, wie konkrete Ereignisse in der Welt unsere Sprache und unseren Sprachgebrauch beeinflussen, so Klosa-Kückelhaus.
Der „Lockdown“
Vom „Shutdown“ klar abzugrenzen ist der „Lockdown“. Dabei handelt es sich im englischen Original um das Inkrafttreten bestimmter Sicherheitsmaßnahmen im Falle eines Attentats oder eines Amoklaufes. Mithilfe dieser Sicherheitsmaßnahmen werden bestimmte Zonen abgeriegelt, sodass die Bevölkerung sich dort nicht mehr frei bewegen kann. Solch eine Bewegungseinschränkung durch Zwangsmaßnahmen gibt es beim „Shutdown“ nicht.
Wort des Jahres 2020: Lockdown auf Platz 2
Kann man das nicht auf Deutsch sagen ...?
Generell gebe es einen Trend, englische Begriffe im Deutschen zu verwenden, erklärt die Sprachforscherin, oftmals gebe es vielleicht kein gutes deutsches Wort dafür – andererseits könne durch ein englisches Wort natürlich auch manches verschleiert werden, weil es viel schicker als das deutsche Pendant wirke. Inzwischen sind sowohl „Shutdown“ als auch „Lockdown“ aber in der deutschen Sprache angekommen: Sie sind in der Orthographie an deutsche Namenwörter angepasst mit Großbuchstaben, haben ein grammatikalisches Geschlecht erhalten und können je nach Anwendung im Satz angepasst werden.
Verschwinden diese Wörter auch wieder?
Insgesamt hänge dies natürlich von der Weiterentwicklung der Corona-Krise ab, meint Annette Klosa-Kückelhaus. Als historische Referenz in Erinnerungen („weißt du noch, damals im Shutdown 2020?“) werden sie uns aber auf jeden Fall noch eine Weile begleiten.
Spuckschutz, Maultäschle, Aluhut: „Neologismus-Wörterbuch“ über Deutsch im Corona-Jahr
Neue deutsche Wörter: Zwischen 2011 und 2020 sind etwa 450 Neuschöpfungen im Deutschen heimisch geworden. Das hat das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim in einem Online-Lexikon festgestellt. Auch die Corona-Pandemie hat die Sprache geprägt, zum Beispiel durch Begriffe wie Corona, Covid 19 oder den Aluhut. Aber auch Wörter wie Schottergarten oder Digitalpakt sind mittlerweile hinzugekommen.
Den besonderen Einfluss der Corona-Pandemie auf den Sprachgebrauch untersucht das IDS mit einer thematisch sortierten Wörter-Liste rund um Corona: Von Abstandsjubeltanz bis Zoomfatigue spiegelt sich darin die Pandemie-Erfahrung der deutschsprachigen Bevölkerung.
Coronavirus: aktuelle Beiträge
Medizin So weit ist BioNtechs Impfstoff-Werk in Ruanda
Seit Herbst 2022 baut das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNtech ein Werk für die Produktion von Impfstoffen in der ruandischen Hauptstadt Kigali – es ist das erste auf dem afrikanischen Kontinent. Der Standort ist nicht zufällig, denn Ruanda ist seit mehr als vier Jahrzehnten Partnerland von Rheinland-Pfalz.
Medizin Kommentar: Kinder sind die größten Verlierer der Corona-Pandemie
Schulausfälle über Wochen, lange Lockdowns und Kontaktverbot. Gerade für Kinder waren diese Einschränkungen in der Corona-Pandemie schwer zu verstehen und zu verkraften. Ein Jahr nach dem Ende der Pandemie ist es Zeit Bilanz ziehen, findet Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Medizin Long Covid: Das weiß die Forschung heute über Ursachen und Therapie
Heute vor einem Jahr hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Pandemie in Deutschland offiziell für beendet erklärt. Für einige ist die Pandemie aber auch jetzt noch nicht vorbei: Sie leiden an Long Covid. Was weiß man heute über die Ursachen? Welche Ansätze gibt es bei der Therapie?
Christine Langer im Gespräch mit Ulrike Till, SWR Wissenschaft
Wort der Woche - weitere Beiträge
Wort der Woche Urbane Landwirtschaft - erklärt von Annette Klosa-Kückelhaus
Nicht nur in Deutschland wird es immer beliebter, Obst und Gemüse auch in der Stadt anzubauen. Damit möchte man sich von der Lebensmittelindustrie unabhängiger machen. „Urbane Landwirtschaft“ nennt sich dieser Trend, den die Sprachwissenschaftlerin Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim unter die Lupe genommen hat.
Wort der Woche Monotasking - erklärt von Bernhard Pörksen
Mal eben schnell die Mails checken und nebenher mit dem Telefon am Ohr noch einen Blick in die Zeitung oder ins Internet werfen. Dafür steht der Begriff Multitasking, der in unserer Gesellschaft meist positiv konnotiert ist, weil er mit Effizienz in Verbindung gebracht wird. Doch ist es wirklich effizienter, alles auf einmal zu machen und sich nicht auf eine Sache zu konzentrieren? Auch der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen hat da so seine Zweifel und schwört auf Monotasking.
Wort der Woche ASMR - erklärt von Annette Klosa-Kückelhaus
Hinter ASMR verbirgt sich eine englische Abkürzung: Autonomous Sensory Meridian Response. Damit ist eine unwillkürlich ablaufende körperliche Reaktion auf bestimmte Geräusche gemeint, im positiven Sinne: Ein leichtes Kribbeln am Kopf, wohlige Schauer, Gänsehaut. Vermittelt durch einen großen und anhaltenden Trend von produzierten ASMR-Videos auf der Plattform Youtube, die Millionen von Nutzerinnen und Nutzern erreichen.