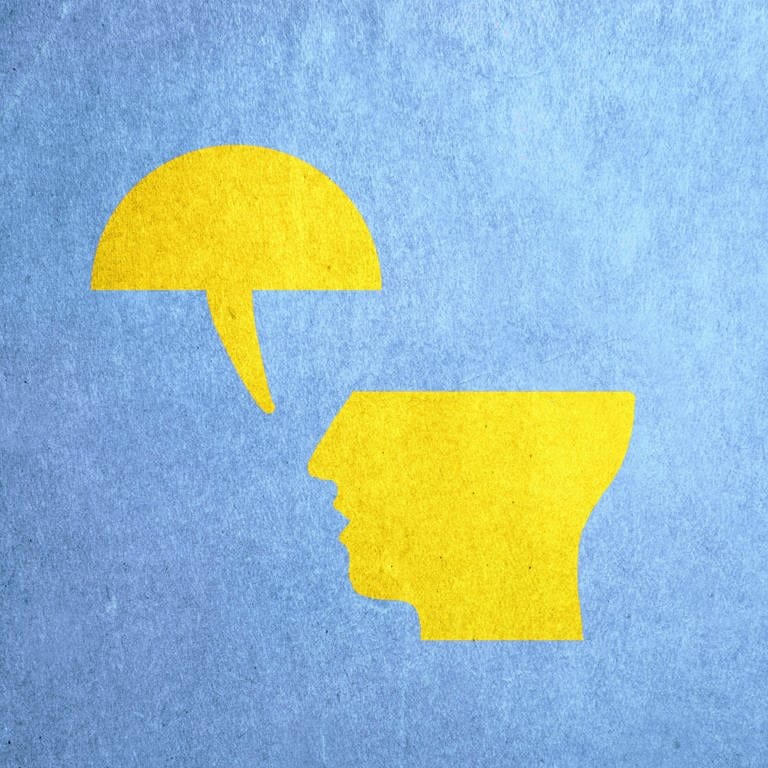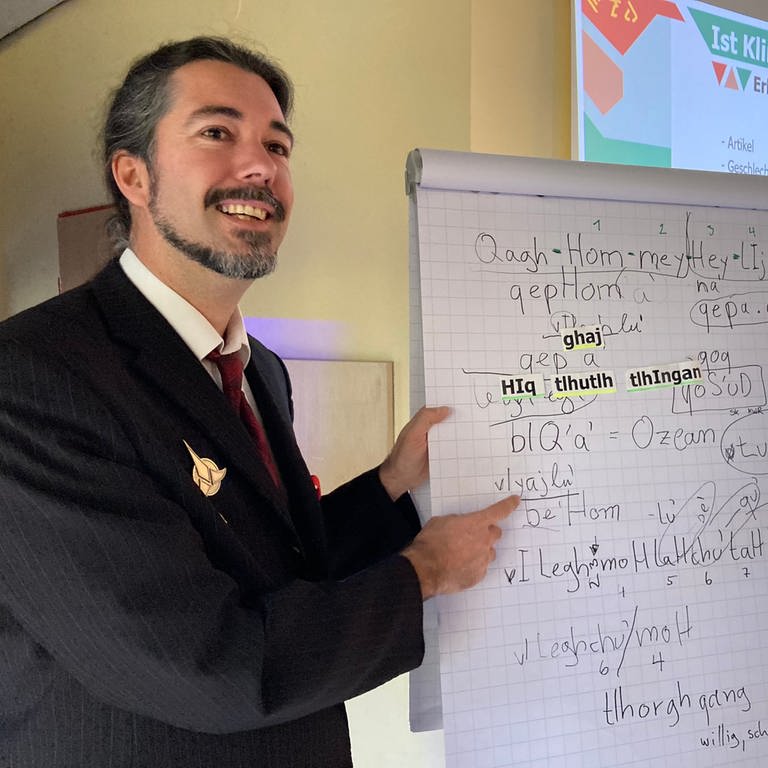Wenn Außerirdische zu uns kämen und uns sprechen hörten, würden sie unsere Sprache dann für eine hochkomplexe Kommunikation halten – oder nur für primitive Laute, die wir ausstoßen, um Grundbedürfnisse nach Essen oder Sex zu äußern? Haben wir vielleicht jahrtausendelang übersehen, dass Tiere anderer Spezies ebenfalls komplexe Dialoge führen? Neue Techniken könnten uns der Antwort auf diese Frage näher bringen.
Das Wörterbuch der sibirischen Unglückshäher
Eine Antwort fanden Forscher bereits im Jahr 2009 bei sibirischen Unglückshähern. Michael Griesser, heute an der Universität Konstanz, fand heraus, dass diese Vögel zum Beispiel für unterschiedliche Feinde unterschiedliche „Wörter“ haben.
Noch frappierender: Manche Vögel haben offenbar auch eine Grammatik. Bei Studien, die er zusammen mit japanischen Forschern an Kohlmeisen durchführte, stellte Michael Griesser fest, dass es bei den Rufen der Vögel durchaus auf die Satzstellung ankommt.

Können Tiere die menschliche Sprache lernen?
Weil es für uns Menschen nicht so leicht ist, die Sprache der Tiere zu verstehen, sind Wissenschaftler in der Vergangenheit meist den umgekehrten Weg gegangen: Sie haben versucht, Tieren unsere Sprache beizubringen, oder eine vereinfachte Version davon.
Berühmt ist zum Beispiel der 2007 verstorbene Papagei Alex, dem die Forscherin Irene Pepperberg 200 menschliche Wörter beibrachte. Und Diana Reiss von der City University of New York hat Delfinen beigebracht, mit ihr über eine Art Tastatur zu kommunizieren, die sie unter Wasser installierte.
Maschinelle Lernverfahren zur Entschlüsselung von Tiersprachen
Die Idee, moderne maschinelle Lernverfahren auf Tiersprachen anzusetzen, lag sozusagen in der Luft. Aza Raskin, ein bekannter Designer von Computer-Benutzeroberflächen, hatte 2013 die Idee, mit Big-Data-Methoden Tiersprachen zu analysieren. Im Radio hatte er einen Beitrag über Forscher der Universität von Michigan gehört, die von dem umfangreichen Vokabular der Dschelada-Paviane erzählten.
"Ihr Vokabular ist riesig. Die Forscher schwören, dass die Affen hinter ihrem Rücken über sie reden."
Aza Rakin überlegte:
"Können wir mit den riesigen Datenmengen von Sensoren und den neuesten Machine-Learning-Methoden versuchen, sie zu verstehen und eine nichtmenschliche Sprache zu dekodieren?"
Doch 2013 war die Technik noch nicht so weit. 2017 gab es dann eine revolutionäre Entwicklung bei der Übersetzung menschlicher Sprachen.
Traditionell lernen wir eine Sprache am leichtesten, wenn wir ein Lexikon haben oder so etwas wie den antiken Stein von Rosette – ein Dokument, auf dem derselbe Inhalt in mehreren Sprachen dargestellt wird. Sowas gibt es natürlich fürs Tierreich nicht. Aber dann entwickelten Forscher bei Facebook ein Programm, das automatisch eine neue, unbekannte Sprache in eine bekannte übersetzen kann – ohne dass man ein Lexikon besitzt.
Aza Rakin erklärt die Idee dahinter und vergleicht das Modell mit einer Galaxie, in dem jeder Stern für ein Wort stehe:
"Wörter mit ähnlicher Bedeutung stehen nahe beieinander: "König" und "Mann" oder "Königin" und "Frau". Diese Muster kann man zum Beispiel für Deutsch und Japanisch übereinanderlegen. Denn die Beziehungen zwischen den Wörtern sind sehr ähnlich – das Wort „Hund“ hat in beiden Sprachen ein gewisses Verhältnis zu den Wörten „Mensch“, „Katze“ oder „Fell“."
Dass Menschen auf der ganzen Welt über ähnliche Dinge reden, kann man sich noch vorstellen. Aber Tiere und Menschen? Ist es wirklich vorstellbar, dass etwa die Pottwale regelrechte Wörter für dieselben Dinge haben wie wir? Aza Raskin kann sich das vorstellen.
CETI: maschinelle Sprachmodelle zur Entschlüsselung von Walgesängen
Die Forscherinnen und Forscher des CETI-Projekts, der „Cetacean Translation Initiative“, setzen auf eine Klasse von Algorithmen, die in den letzten Jahren eine sprunghafte Entwicklung in der Modellierung von menschlicher Sprache genommen hat. Diese Programme erkennen aus großen Mengen von Texten oder Tonaufzeichnungen die Struktur einer Sprache, ohne irgendwas über Wörter oder Sätze zu wissen.

Diese Sprachmodelle werden von CETI nun auf Pottwale angewendet. Die Herausforderung des nächsten Jahres wird darin bestehen, die entsprechenden Sensoren zu entwickeln, um sowohl die Äußerungen der Pottwale aufnehmen als auch ihr Verhalten protokollieren zu können. Im Sommer 2022 soll mit der Sammlung der Daten begonnen werden.
Direkte Kommunikation noch nicht als Ziel definiert, aber "Chatbot" für Wale
Das Ziel ist vorerst nicht die direkte Kommunikation zwischen Mensch und Wal. Aber vorstellbar ist, dass die Forscherinnen und Forscher eine Art Chatbot entwickeln, den man im Ozean zu den Walen sprechen lässt – und dann muss man sehen, wie die Tiere darauf reagieren.
Nicht nur der Name des CETI- Projekt erinnert an SETI mit S – den Versuch, mit völlig fremden Zivilisationen im All ins Gespräch zu kommen. Statt die Antennen auf den Weltraum zu richten, kann man im Meer eine Kultur belauschen, die uns Menschen mindestens genauso fremd ist – nur, dass die Aliens hier auf der Erde sind und wir ihre Kommunikation in Echtzeit belauschen können.
Keine Aussicht auf Übersetzungsapp für Hansi, Bello und Peterle
Eine Übersetzungs-App jedoch wird es wohl auf absehbare Zeit nicht für Haustiere geben und auch nicht für Wale.