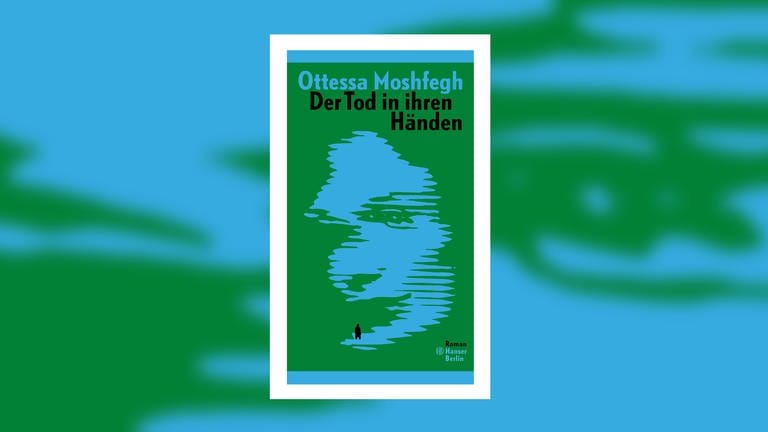Lapvona ist ein gottverlassenes Dorf irgendwo im tiefsten Mittelalter oder auch in einer katastrophalen Zukunft. Das macht keinen Unterschied. Die amerikanische Autorin Ottessa Moshfegh hat ihren neuen Roman in einem ahistorischen Nirgendwo angesiedelt, wo die Menschen ganz auf sich zurückgeworfen sind. Aber was heißt das noch: Menschen – wenn sie durch nichts weiter bestimmt sind als durch Grausamkeit, Gier, Dummheit und Eigennutz?
In regelmäßigen Abständen überfallen Räuber das Dorf, so auch gleich zu Beginn dieser archaischen Phantasie. Einer der Räuber wird gefangen genommen, gefoltert, gehängt und anschließend ausgeweidet. Ottessa Moshfegh setzt immer noch eins drauf und beschreibt den Vorgang so sachlich wie möglich. In ihrem unbeteiligten, chronikhaften Ton wirkt die geschilderte Brutalität umso drastischer. Einer, der dabei zuschaut, ist der kleine Marek, Sohn des Schafhirten. Er ist ein verwachsener Krüppel, rothaarig, bucklig, krumm.
Marek war hässlich. Und schwach. Von seinem Vater erfuhr er nicht, dass sein Gesicht unmögliche Proportionen hatte: Auf der hohen Stirn des Jungen traten die Adern stark hervor, er hatte eine krumme Kartoffelnase, dünne Lippen und ein Kinn, das übergangslos in einen runzligen, faltigen Hals mündete, an dem die Haut wie ein Vorhang über Kehle und Adamsapfel hing. „Schönheit ist der Schatten des Teufels“, sagte sein Vater.
Fast könnte man Mitleid haben mit diesem erbärmlichen Geschöpf, das um Zuneigung giert und sich selbst erniedrigt, um wenigstens Gott zu gefallen. Doch Mitleid zu haben, wäre verkehrt, denn die Unterdrückten sind bei Moshfegh nicht besser als die Unterdrücker. Nur schwächer. Marek, der Niedrigste, Verachtetste des Dorfes, schafft es, den Sohn des tyrannisch herrschenden Landgrafen aus dem Weg zu räumen und selbst dessen Stelle im Schloss einzunehmen. So wird aus dem Gepeinigten ein Peiniger.
Der Landgraf hält die Dorfbewohner in Leibeigenschaft und, so könnte man sagen, in ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Priester des Dorfes ist der Freund des Grafen. Er predigt Gottesfurcht, weiß aber, dass Religion vor allem der Herrschaftssicherung dient. Wer an Gott glaubt, ist selbst schuld.
Wenn Gott einem mehr abverlangt, als man ertragen kann, verlässt man sich auf seinen Instinkt. Und Instinkt ist eine Macht, die niemand kontrollieren kann.
Der Graf herrscht mit Terror und Lügen, ist aber ein Schwächling und, wie sich bald herausstellt, ziemlich irre. Der Kaiser ist nackt, scheint Moshfegh nahelegen zu wollen. Doch als Parabel auf Macht und Unterwerfung taugt der Roman nicht, weil er alle konkreten historischen Bezüge verweigert. Auch die Hungersnot, die nach einer katastrophalen Sommerdürre ausbricht, verweist nicht etwa auf den Klimawandel, sondern nur auf die Skrupellosigkeit des irren Schlossherren, der das Wasser aus den Bergen speichert, um seinen Badesee zu füllen.
Moshfegh lässt nichts aus, weder Inzest noch Dekadenz, weder Vergewaltigung noch Kannibalismus. Ihre Schilderungen sind bis über die Ekelgrenze hinaus detailliert, geraten gelegentlich aber auch slapstickhaft, wie in einem Film von Tarantino, etwa dann, wenn Mareks Vater in der Hungersnot eine Leiche zerlegt und verspeist. Das ist drastisch und schockierend. Die fortgesetzten Übersteigerungen führen jedoch zu keiner Erkenntnis oder Befreiung, sondern bloß zu wachsender Langeweile. Das liegt auch daran, dass die Figuren und Ereignisse allzu ausgedacht wirken, um irgendwo in der Realität zu ankern.
„Lapvona“ ist eine literarische Versuchsanordnung, die immer nur das beweist, was die Autorin voraussetzt: Der Mensch ist böse, roh und gemein. Das ist als Programm ein wenig schlicht, weil es auf jede gesellschaftliche oder psychologische Analyse verzichtet. Das Böse gibt es. Das wissen wir. Die anspruchsvollere Frage wäre jedoch, woher das Gute kommt, wie die Liebe entsteht und wo das Schöne sich zeigt. Mit diesen Fragen beginnt doch eigentlich erst die Literatur, indem sie auf das Mögliche verweist und das Gegebene als veränderbar zeigt. In diese Richtung hat Ottessa Moshfegh leider keinerlei Ambitionen.