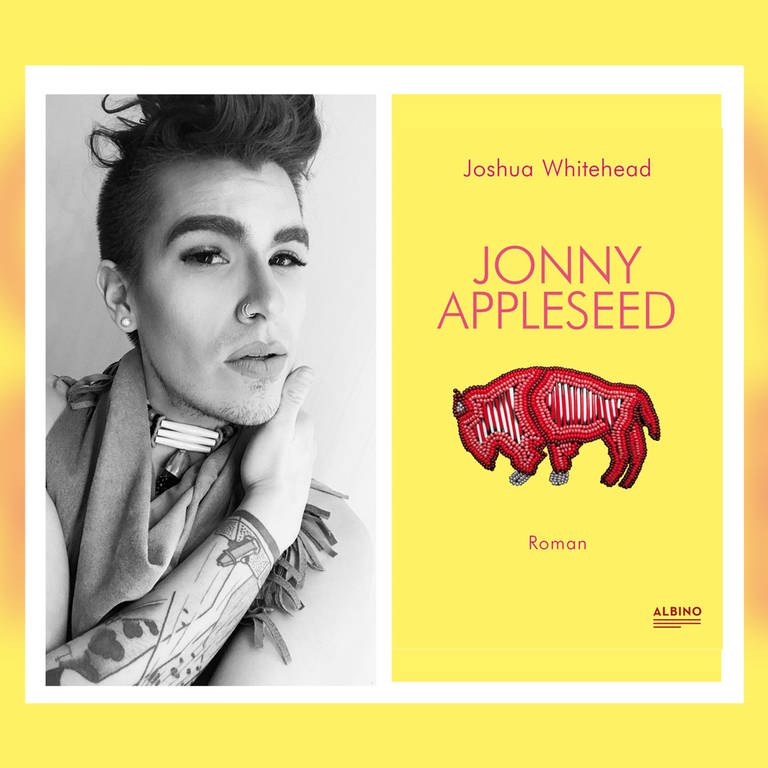Was heißt es, heutzutage ein Indianer zu sein? Zwölf Native Americans auf dem Weg zu einem Powwow suchen nach einer Antwort auf diese Frage. Der Autor Tommy Orange weiß, wovon er schreibt: Er ist selbst Mitglied der Cheyenne und Arapaho Tribes.
Schauplatz ist ein Powwow in Oakland
Im Stadion von Oakland in Kalifornien findet ein Powwow statt. Ein großes Treffen von Indianern, das den Zweck hat, den gemeinschaftlichen Geist zu stärken und indianische Traditionen zu feiern. Drei Tage lang soll gesungen, um die Wette getanzt, getrommelt und gegessen werden.
Doch das Fest versinkt in einem Alptraum.
Aber der Reihe nach: In „Dort dort“, dem Roman von Tommy Orange, machen sich zwölf Indianer der Jetztzeit auf den Weg zu dieser Versammlung.
Zwölf Lebensgeschichten werden miteinander verflochten
Zwölf Amerikaner mit indianischen Wurzeln, deren Lebens-Geschichten sich im Laufe des Romans immer stärker miteinander verflechten: Eine Großmutter, die als Postbotin jobbt. Ein Hausmeister. Ein Dokumentarfilmer. Die junge Blue, die aus einer gewalttätigen Ehe flüchtet. Oder der Internetjunkie Edwin, der bei dem Treffen endlich seinen indianischen Vater kennenlernen möchte.
Außerdem sind da einige Drogendealer und Gelegenheitsdiebe, die einen Raubüberfall auf die Powwow-Kasse planen. Zu ihnen gehört der 21-jährige Tony Loneman, dessen Gesicht entstellt ist von einem angeborenen Alkoholsyndrom, das er selbst nur „das Drom“ nennt. Zwar kommt der Roman ohne Hauptfigur aus, aber Tony, dieser Kleindealer und Möchtegernrapper, dient als eine Art erzählerische Klammer.
Meine Augenlider hängen runter, als wäre ich fertig, als wäre ich high. Und mein Mund steht die ganze Zeit offen. Zwischen den einzelnen Teilen in meinem Gesicht ist zu viel Platz. Augen, Nase und Mund stehen so weit auseinander, als hätte sie ein Säufer beim Griff nach dem nächsten Schluck da hingeklatscht. Die Leute gucken mich an und dann schnell weg, wenn sie sehen, dass ich es merke. Auch das ist das Drom. Meine Kraft und mein Fluch. Das Drom ist meine Mom und warum sie trank. Es ist Geschichte, die in einem Gesicht landet.
Tony ist mehr als der klassische Antiheld
Doch Tony Loneman steht auch für das Verhältnis oder besser gesagt für das Nicht-Verhältnis großer Teile der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft zu den Nachkommen der Ureinwohner. Für Autor Tommy Orange ist Tony mehr als der klassische Antiheld.
Tony ist sich bewusst, dass niemand ihn sehen will. Genauso fühlt es sich in Amerika an, Native zu sein. Die meisten Leute wollen sich die Vergangenheit nicht anschauen. Die Gesellschaft verlangt nach einer Geschichte, die sie stolz macht. Die ihnen patriotische oder neuerdings nationalistische Gefühle vermittelt. Und nicht nach etwas Dunklem, das nicht schön anzuschauen ist.
So ganz stimmt diese Analyse nicht mehr, denn dieses immens politische Buch schaut ja ganz genau hin und war in den USA einer der größten literarischen Bestseller der vergangenen Jahre.
Aber Tommy Orange weiß, wie schwer es ist, sich gegen Klischees zu wehren. Weil seine Mutter Weiße ist, wurde er oft als Chinese beschimpft und noch öfter für einen Mexikaner gehalten.
Er hat in einem Gesundheitszentrum mit Natives gearbeitet. Mit Menschen, die in dem Teufelskreis aus Armut, Drogen und Hoffnungslosigkeit feststeckten. Und den Bezug zu ihrer Herkunft fast verloren hatten. Eine Erfahrung, die auch Tommy Orange nicht fremd ist.
Die Muttersprache meines Vaters ist Cheyenne. Er konnte kein Wort Englisch, bis er in die Schule kam. Erst mit fünf Jahren hat er zum ersten Mal einen Weißen gesehen. Er ist in einem sehr traditionellen Umfeld groß geworden, aber er wurde von seinem Vater nie akzeptiert. Er ist mit uns nach Oakland/ Kalifornien gezogen, um seinem Schmerz nicht wiederbegegnen zu müssen. Und auch sein Entschluss, uns nicht die Sprache, die Tradition und Kultur beizubringen, hatte mit diesem Schmerz zu tun.
Wie kann man eine Erinnerung verkörpern, die nicht die eigene ist?
Im Roman sind etliche Figuren auf der Suche nach ihren indianischen Wurzeln. Alle stehen dabei vor der Kern-Frage: Wie soll das gehen: eine Erinnerung zu verkörpern, die man selbst nicht mehr hat? Weil die Väter abgehauen sind, die Mutter Selbstmord begangen hat.
Der vierzehnjährige Orvil Red Feather etwa findet im Schrank seiner Großmutter eine alte Indianertracht und will nun als Tänzer auf dem Powwow auftreten. Auf Youtube schaut er sich an, wie das geht: Tanzen wie ein Indianer. Dann übt er.
Seinem eigenen Urteil nach ist er als Indianer verkleidet, wie er da in seiner zu kleinen, geklauten Tracht vor dem Spiegel steht. Mit Fell und Zopfspange, Webbändern und Federn, Knochen-Brustpanzer und hochgezogenen Schultern steht er da, weich in den Knien, eine Fälschung, eine Kopie. Ein Junge in Verkleidung. Und doch ist da etwas, hinter dem dummen, glasigen Starren, das er seinen Brüdern so oft zeigt, hinter diesem kritischen, grausamen Blick, er kann es fast sehen, deshalb schaut er weiter, steht weiter vor dem Spiegel. Er wartet darauf, dass sich ihm etwas Wahres offenbart – über ihn.
Indianer, die Indianer spielen
Indianer, die Indianer spielen, um mit ihrem eigenen Indianischsein in Kontakt zu kommen - dem jungen Orvil kommt das merkwürdig vor. Seine kleinen Brüder kapieren gar nicht, was das soll. Aber in der amerikanischen Geschichte gab es noch viel Merkwürdigeres erzählt Tommy Orange:
In den 1880er Jahren gab es „Buffalo Bill‘s Wild West Show“, wo berühmte Häuptlinge wie Sitting Bull bezahlt wurden, um sich selbst zu spielen. Aber sie haben übertrieben und den weißen Amerikanern gezeigt, was sie glaubten, das die sehen wollten.
Die vielen Stimmen der Stadt-Indianer bleiben unterscheidbar
Tommy Orange und seinem Übersetzer Hannes Meyer gelingt es erstaunlich gut, den vielstimmigen Chor der Stadt-Indianer sprachlich unterscheidbar zu halten. Werden die einzelnen Figuren zu Beginn in längeren Kapiteln vorgestellt, mal in der Ich-Form, mal in der dritten Person, so wechseln die Stimmen zum Ende hin in immer schnelleren Tempo. Wer da den Überblick verliert, dem hilft ein Figurenverzeichnis auf die Sprünge.
Gertrude Stein: „Es gibt kein dort dort!“
Der Titel „Dort Dort“ spielt an auf ein Zitat der Schriftstellerin Gertrude Stein, die einen Teil ihrer Kindheit in Oakland verbrachte. Als Stein Jahre später die Orte sehen wollte, in denen sie aufgewachsen war, musste sie feststellen, dass sie nicht mehr existierten. In „Jedermanns Autobiografie“ hielt sie lapidar fest: „Es gibt kein dort dort!“
Als ich das las, erinnerte mich das an die Erfahrung, die die Natives gemacht haben. Alle haben diese Vorstellung von den Indianern, die im Reservat leben, auf dem Pferd sitzen - all diese Klischees. Ich habe zehn Jahre in der Community der Native Americans von Oakland gearbeitet und viele Leute kennengelernt, die sich als urbane Indianer bezeichnen. Sie sind immer noch Natives – selbst, wenn es fast nicht mehr erkennbar ist.
Tommy Orange hat den "urban natives" ein Denkmal gesetzt
Mit anderen Worten: Tommy Orange geht es weniger darum, einen Verlust zu beklagen. Sondern unseren Blick darauf zu lenken, wer und was da ist. Ohne zu verklären. Mit „Dort Dort“ hat er den urban natives ein wuchtiges, ein emotionales Denkmal gesetzt.
Ein wichtiges Buch – und ein zärtliches
Geschrieben hat er große Teile des Romans übrigens: im Liegen., Auf die Ellbogen gestützt, den Laptop vor sich, lauschte er im Morgengrauen den Stimmen in seinem Kopf, aus denen dann seine Figuren entstanden. Der Grund für die unbequemen, aber produktiven Nachtschichten: Orange war gerade Vater geworden, sein Sohn Felix schlief nebenan. Womöglich ist dieses wichtige Buch deshalb - trotz aller bedrückenden Wahrheiten - auch ein zärtliches geworden.