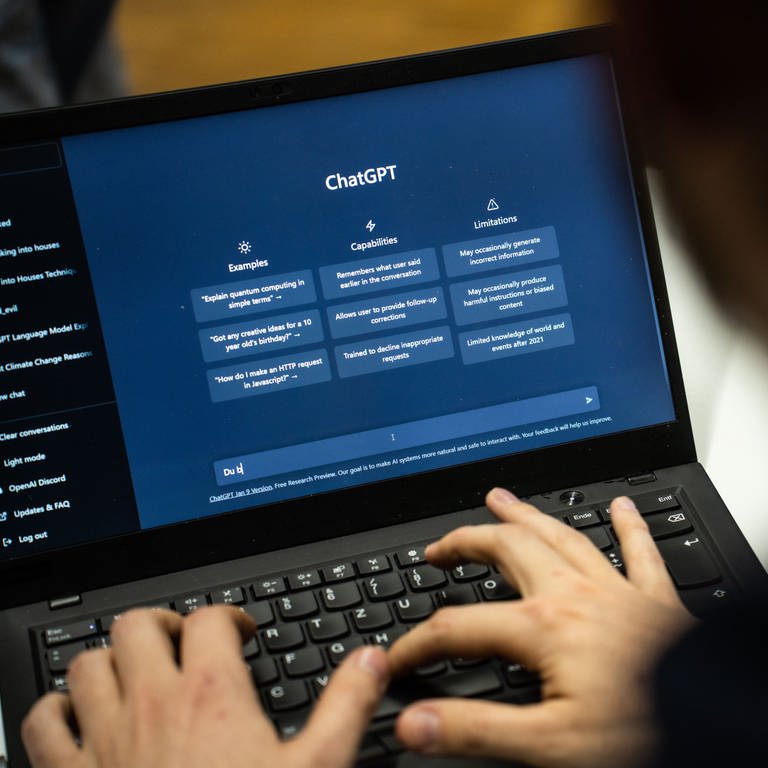Am 3. Mai 2008 trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft, die Menschen mit Behinderungen die uneingeschränkte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen soll. Besonders wichtig dafür ist der Zugang zu Bildung. Deutschland trat der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte Behinderter am 26. März 2009 bei. Dies galt als wichtiger Schritt hin zur Änderung der deutschen Schullandschaft, die die Bundesländer jedoch mit unterschiedlichem Tempo angehen.
Inklusion in Baden-Württemberg
Der Landtag von Baden-Württemberg verabschiedete 2015 eine Änderung des Schulgesetzes zur Inklusion. Seit dem können Eltern von Kindern mit Behinderungen wählen, ob ihr Kind an einer allgemeinen Schule oder an einer Sonderschule lernen soll. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2018 ist die Inklusionsquote an baden-württembergischen Schulen mit knapp fünf Prozent allerdings so gering wie in kaum einem anderen Bundesland.

In inklusiven Klassen fehlt das Personal
Viele Eltern von behinderten Kindern sind nicht überzeugt davon, wie Inklusion derzeit umgesetzt wird. Zwar hat mittlerweile jedes Kind ein Recht darauf, inklusiv beschult zu werden. Doch es ist längst nicht garantiert, dass einem behinderten Kind täglich und über die gesamte Unterrichtszeit ein Sonderpädagoge oder auch eine Betreuungsperson zur Seite steht. Den Schulen fehlen oft zusätzliche Mittel und qualifiziertes Personal.

Kosten für Inklusion sind hoch
Die Ausgaben für das baden-württembergische System, das nach wie vor eigene Sonderschulen als auch Sonderpädagogen in Regelschulen vorsieht, sind bereits jetzt immens. Der Bundesrechnungshof hat für Niedersachsen, wo ein ähnliches System in Kraft ist, errechnet: Wenn alle derzeit noch existierenden Sonderschulen aufgelöst würden, könnte man sämtliche Klassen aller Schulformen zusätzlich mit knapp sechs Stunden Förderunterricht ausstatten.
Sechs Stunden mehr Förderunterricht wären eine immense Entlastung für die Lehrer der Regelschulen und würde die Betreuung behinderter Kinder sehr erleichtern. Bislang jedoch sind das nur Rechenspiele, die Praxis sieht anders aus.
Weg vom Frontalunterricht
Frontalunterricht, der davon ausgeht, dass alle Kinder im Gleichschritt lernen können, ist an den meisten Gymnasien gang und gäbe. Für Kinder mit Behinderung ist diese Unterrichtsmethode in der Regel ein Problem. Für gelingende Inklusion müsse sich der Unterricht daher allgemein ändern, sagt Kerstin Merz-Atalik, Professorin für Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung sowie Inklusion an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Südtirol als Musterbeispiel für gute Inklusion
Andere Länder machen vor, wie Inklusion gelingen kann. Südtirol etwa gilt als Musterbeispiel für die Inklusion an Schulen. Alle Kinder mit und ohne Behinderung besuchen dort eine allgemeine Grundschule bis zur achten Klasse. Es gibt keine Sonderschulen. Selbst schwer mehrfach behinderte Kinder oder sogar Kinder, die im Wachkoma liegen, sind in den Schulalltag integriert. Dabei ist es selbstverständlich, dass alle Kinder zwar gemeinsam, aber jedes nach seinem Tempo lernen darf:
Erst ab Klassenstufe 9 gibt es in Südtirol eine Trennung in Gymnasium und berufliche Schule oder Ausbildung. Diese Entscheidung treffen die Eltern jedoch mit. Die Schulen kümmern sich um das für jedes Kind passende Angebot. Und auch die Architektur ist barrierefrei. Jeder Kindergarten, jedes Schulhaus ist behindertengerecht gebaut.
Frühe Trennung der Kinder als Problem
Für Pädagogik-Professorin Merz-Atalik ist die frühe Trennung der Kinder in Deutschland eines der Haupt-Hindernisse für gelingende Inklusion. Bereits in der Grundschule herrsche ein enormer Leistungsdruck. In kaum einem anderen europäischen Land werde darüber hinaus so vielen Kindern ein Förderbedarf attestiert wie in Deutschland. Merz-Atalik legt nahe, dass dies auch damit zusammenhänge könne, dass das deutsche Schulsystem besonders starr sei und viele Kinder deshalb aus dem Raster fielen.
Widersprüchliche Inklusion in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg führen die Inklusionsbemühungen zu absurden Situationen. Denn Kinder mit Behinderung werden in ein segregatives Schulsystem integriert. In derselben Klasse sitzen nun also Regelschüler zusammen, die ohne entsprechende Leistungen nicht versetzt werden. Ihre Klassenkameraden mit Behinderung werden jedoch von Klasse zu Klasse mitgenommen, selbst wenn sie im Zweifel nicht einmal richtig lesen und schreiben könnten. Das bringt viele Lehrer in Erklärungsnöte.
Kleine Fortschritte in Inklusions-Debatte
Ohne grundlegende Änderungen im Schulgesetz wird Inklusion nicht gelingen, sind sich die meisten Experten einig. Immerhin: ein Fortschritt in der Inklusions-Debatte ist erkennbar. Denn bis vor wenigen Jahren wurde noch diskutiert, ob Inklusion überhaupt gelingen könne. Heute steht das außer Frage. Dafür streiten Schulträger, Lehrer und Eltern jetzt über die konkrete Umsetzung.